Clausewitz und Sun Tzu: Paradigmen der Kriegführung im 21. Jahrhundert
Geschichte- Datum:
- Lesedauer:
- 15 MIN


Siegen ohne zu kämpfen. Dies ist schon vor 2500 Jahren das Ideal des Theoretikers der Kriegskunst Sun Tzu. Russland ist damit in der Ukraine gescheitert. Warum Sun Tzu aber immer noch aktuell ist, erklärt Andreas Herberg-Rothe und vergleicht ihn mit Carl von Clausewitz, der verfrüht von den Theoretikern der „Neuen Kriege“ sowie der „Revolution in military affairs“ für überholt erklärt wurde.

Täuschung im Sinne Sun Tzus: Waffen-, Fahrzeug- und Soldatenattrappen werden auch im Krieg in der Ukraine eingesetzt.
picture alliance / ASSOCIATED PRESS„Siegen ohne zu kämpfen“ – dies ist das Ideal des altchinesischen Theoretikers der Kunst des Krieges, Sun Tzu. Ganz offensichtlich war dies auch die Vorstellung der russischen Militärführung bei ihrem Angriff auf die Ukraine, als sie versuchte, den Widerstand des Gegners zu brechen, bevor es zu größeren Kamphandlungen kommt. Diese Annahme hat sich bezüglich der Ukraine als falsch erwiesen, denn ein Ende ist noch nicht abzusehen. Zumindest hat der Krieg sehr schnell einen eher klassischen Charakter des Staatenkrieges angenommen.
In Fragen von Krieg und Kriegführung gibt es zwei einflussreiche Theoretiker, deren Konzeptionen noch heute präsent sind: den preußischen „Philosophen des Krieges“ Carl von Clausewitz (1780–1831), der für das Werk „Vom Kriege“ verantwortlich zeichnet, und den altchinesischen Militärstrategen der „Kunst des Krieges“ Sun Tzu (auch Sunzi, um 544 v.Chr.–um 496 v.Chr.). Keine der von ihnen entworfenen Strategien kann jedoch für alle Fälle gleichermaßen gelten.
Vergliche man die unterschiedlichen Ansätze Sun Tzus und Clauswitz’, so ist Clausewitz’ Ansatz eher mit einem Ringkampf oder Boxkampf zu vergleichen, Sun Tzus dagegen mit dem Jiu-Jitsu. Ziel eines Boxkampfs ist es, den Gegner durch die Schläge auf seinen Körper kampfunfähig zu machen, wie Clausewitz selbst hervorhebt, um ihn dadurch zu einem Frieden zu zwingen. Demgegenüber ist das Ziel von Sun Tzu, den Gegner aus dem Gleichgewicht zu bringen, so dass selbst ein leichter Schlag ihn zu Boden zwingt, weil er durch seine eigenen Kraftanstrengungen zu Fall gebracht wird.
Natürlich spielen beide Aspekte eine große Rolle sowohl bei Clausewitz wie Sun Tzu, aber Clausewitz’ Strategie bezieht sich mehr auf den Körper, die materiellen Mittel, die die Kriegsgegner zur Verfügung haben, Sun Tzus Strategie mehr auf den Geist, den Willen zu kämpfen. Doch auch bei Clausewitz spielt der Wille eine große Rolle. In „Vom Kriege “ definiert er den Krieg als einen Akt der Gewalt, um den Gegner zur Erfüllung des eigenen Willens zu zwingen.
Wie aber wird der Gegner in Clausewitz’ Konzeption hierzu gezwungen? Wenige Seiten weiter heißt es: indem die Streitkräfte des Gegners vernichtet werden. Unter dem Begriff „Vernichtung“ verstand Clausewitz aber nicht primär eine physische Zerstörung, sondern das Ziel, die Streitkräfte des Gegners in einen solchen Zustand zu versetzen, dass sie den Kampf nicht mehr fortsetzen können.

Einflussreicher Theoretiker des Krieges: Carl von Clausewitz
akg-images
Auf den ersten Blick ist Clausewitz’ Position nicht mit der von Sun Tzu zu vereinbaren. In seiner weltberühmten Formel, die Krieg als „Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln“ begreift, nimmt Clausewitz eine hierarchische Positionierung vor, die Politik bestimmt den übergeordneten Zweck des Krieges. Direkt vor dieser Formel schreibt er jedoch, dass die Politik den ganzen kriegerischen Akt durchziehen werde, aber nur insoweit die Natur der in ihm explodierenden Kräfte dies zulasse. Durch diese Aussage relativiert er die Überschrift des 24. Kapitels seines Werks „Vom Kriege“, die als einzige die weltberühmte Formel enthält.
Noch deutlicher wird das in der Formel nur implizit angelegte Spannungsverhältnis in der „wunderlichen Dreifaltigkeit“, Clausewitz’ „Resultat für die Theorie“ des Krieges. Hier schreibt er, dass der Krieg nicht nur ein wahres Chamäleon sei, weil er in jedem konkreten Fall seine Natur etwas ändert, sondern eine wunderliche Dreifaltigkeit. Diese sei zusammengesetzt aus der ursprünglichen Gewaltsamkeit des Krieges, dem Hass und der Feindschaft, die wie ein blinder Naturtrieb anzusehen seien, dem Spiel der Wahrscheinlichkeiten und des Zufalls sowie der untergeordneten Natur des Krieges als Instrument der Politik, wodurch der Krieg dem bloßen Verstand anheimfalle.
Gewalt, Hass und Feindschaft wie ein blinder Naturtrieb auf der einen Seite, bloßer Verstand auf der anderen, dies ist der entscheidende Gegensatz in Clausewitz’ wunderlicher Dreifaltigkeit. Alle drei Dimensionen der wunderlichen Dreifaltigkeit sind für Clausewitz jedem Krieg eigen, ihre unterschiedliche Zusammensetzung mache die Unterschiedlichkeit der Kriege aus.

Krieg als Chamäleon: Das Zusammenwirken verschiedener Kräfte beeinflusst gemäß Clausewitz den Charakter eines jeden Krieges.
Während Clausewitz in der anfänglichen Definition und der weltberühmten Formel, Krieg sei die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln, eine eindeutige Hierarchie zwischen Zweck, Ziel und Mittel des Krieges formuliert, ist die wunderliche Dreifaltigkeit von einer prinzipiellen Gleichrangigkeit der drei Tendenzen der Gewaltsamkeit, dem Kampf und der Instrumentalität des Krieges gekennzeichnet. Im Kern ist Clausewitz’ wunderliche Dreifaltigkeit eine hybride Bestimmung des Krieges, weshalb in englischen Fassungen auch öfters der Begriff „paradoxical trinity“ verwandt wird.
Auch wenn Clausewitz das Bild des Ringkampfes zu Beginn seines Werkes verwendet, um seine Konzeption zu veranschaulichen, passt das Beispiel des Boxkampfes noch besser. Hier gibt es einen abgegrenzten Raum, auf dem gekämpft wird (Kriegsschauplatz), bestimmte Schläge sind erlaubt oder verboten (Kriegskonventionen bilden sich), der Kampf beginnt mit dem Gong (Kriegserklärung) und endet mit einem Punktsieg (Friedensschluss) oder dem Niederschlag (Kapitulation).
In jedem Fall spielt die Politik vor dem Krieg, im Krieg und nach dem Krieg die entscheidende Rolle. In Sun Tzus Konzeption ist dagegen das eigene Überleben, die Selbsterhaltung der eigenen physischen oder symbolischen Identität das ausschlaggebende Motiv – und das mit allen Mitteln, jederzeit, an jedem Ort und auf allen Ebenen.
Oftmals kann erst im Nachhinein eine Erklärung für Erfolg oder Misserfolg in einem Krieg in den jeweils angewandten Strategien gesucht werden. So wurde von Colonel Harry G. Summers beispielsweise die Niederlage der USAUnited States of America im Vietnamkrieg auf die Nichtberücksichtigung der Einheit von Volk, Armee und Regierung, gemäß der Clausewitz’schen „wunderlichen Dreifaltigkeit“, zurückgeführt. 1991 trat demgegenüber der Generalstabschef der USUnited States-Armee, General Colin Powell, nach dem erfolgreichen Feldzug gegen den Irak mit Clausewitz’ Buch „Vom Kriege“ vor die Presse und signalisierte damit, dass man aus den Fehlern des Vietnamkrieges gelernt und „mit Clausewitz“ den Irak-Krieg gewonnen habe.
Gleichermaßen wurde nach dem Ersten Weltkrieg in Deutschland die Diskussion geführt, die deutschen Generale hätten den Krieg nicht verloren, wenn sie Clausewitz richtig gelesen hätten. Diese Schlussfolgerung bezog sich auf den Sieg der deutschen Streitkräfte im deutsch-französischen Krieg (1870/71) und der Einschätzung des damaligen Generalstabschefs, Generalfeldmarschall Helmuth von Moltke, dass er diesen Krieg aufgrund des Studiums von Clausewitz’ „Vom Kriege“ erfolgreich habe führen können. Seitdem wird in diesem Werk nach den richtigen Strategien für den Sieg und Gründen für die Niederlage gesucht.

Gewann seit der Jahrtausendwende an Bedeutung: der chinesische Militärtheoretiker Sun Tzu
picture alliance / CPA Media Co. Ltd
Schien der Status von Clausewitz nach dem Irak-Krieg 1991 bei den westlichen Streitkräften unangefochten zu sein, wurde er seit der Jahrtausendwende schrittweise in Frage gestellt und oftmals durch Ansätze von Sun Tzu sowohl im militärischen als auch im öffentlichen Diskurs ersetzt.
Zwei Gründe spielten hier eine Rolle – einerseits die neuen Formen nicht-staatlicher Gewalt und andererseits die neuen technologischen Möglichkeiten, die Revolution in Military Affairs (RMA), die noch längst nicht abgeschlossen ist. Insbesondere robotische und hybride Kriegführung sowie die Einbeziehung künstlicher Intelligenz, die des Weltraums und die Entwicklung von Quantencomputern sind hier zu nennen. Auslöser der militärtheoretischen Orientierung weg von Clausewitz hin zu Sun Tzu war das Auftreten einer nur scheinbar neuen Form des Krieges, der sogenannten Neuen Kriege. Diese sind historisch betrachtet kein gänzlich neues Phänomen, sondern Bürgerkriege oder militärische Auseinandersetzungen unter der Beteiligung von nicht-staatlichen Gruppen.
Aus Sicht der prägenden Theoretikerin der „Neuen Kriege“ Mary Kaldor ersetzen nicht-staatliche Kriege den zwischenstaatlichen Konflikt. Diese werden auch als „irregulär“ bezeichnet, weil eine klare Unterscheidung zwischen Soldaten und Zivilisten nicht mehr gegeben ist. Sie würden sich durch eine besondere Grausamkeit der Kriegführenden auszeichnen, zu denen Kindersoldaten, Warlords, Drogenbarone, archaische Kämpfer, Terroristen und gewöhnliche Kriminelle, die zu Freiheitskämpfern stilisiert wurden, zählen.
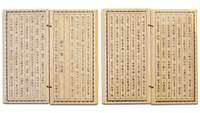
Replik des Manuskripts von Sun Tzus „Die Kunst des Krieges“, 5. Jh. v. Chr.
IMAGO/Pond5 Images
Da Sun Tzu im 6. Jahrhundert v. Chr. und damit in einer Zeit immerwährender Bürgerkriege in China lebte, schien sein Werk „Kunst des Krieges“ für militärische Strategen besser auf den innerstaatlichen Krieg anwendbar zu sein, während die Konzeption von Clausewitz, die im 19. Jahrhundert entstanden war, dem zwischenstaatlichen Krieg zugeschrieben wurde.
In der Bekämpfung der neuen, nicht-staatlichen Waffenträger und der mit diesen verbundenen „Gewaltmärkten“, Bürgerkriegsökonomien und „gewaltoffenen Räumen“ wurde der Leitsatz Napoleons verwandt: „Gegen Partisanen helfen nur Partisanen“. Dementsprechend wurden etwa von John Keegan und Martin van Creveld Konzeptionen der Kriegführung entwickelt, die auf einen mit modernsten Technologien ausgerüsteten archaischen Kriegertypus hinausliefen. Auf militärpraktischer Ebene erfolgte der Umbau von Teilen der westlichen Streitkräfte wie auch der Bundeswehr mit der schrittweisen Beteiligung an Out-of-Area-Einsätzen seit den 1990er Jahren von einer Verteidigungsarmee zu einer Interventionsarmee. Den bewaffneten Kampf führten fortan hochprofessionelle Spezialkräfte in komplexen Konflikten.
Der anfängliche Erfolg der USUnited States-Armee in Afghanistan ist auf den Einsatz von solchen Spezialkräften zurückzuführen, die etwa infolge der modernen Kommunikationsmöglichkeiten jederzeit die überlegene USUnited States-Luftwaffe zur Unterstützung rufen konnten. Im Unterschied zu den USAUnited States of America, die sich stärker auf die militärische Dimension konzentrierten, wurde seitens der Bundeswehr der Zivilgesellschaft in diesen Bürgerkriegsökonomien ein größeres Gewicht beigemessen und im Idealfall wandelte sich der Soldat zum „Sozialarbeiter in Uniform“.
Noch deutlicher wurde der Paradigmenwechsel von Clausewitz zu Sun Tzu im Irakfeldzug 2003. Aus der Sicht eines Kommentators (Ralph Peters) wurde dieser Feldzug in nur wenigen Wochen gewonnen, weil sich die USUnited States-Armee an Prinzipien Sun Tzus orientierte, während die russischen Berater Saddam Husseins sich an Clausewitz und die Verteidigung Moskaus gegen Napoleon hielten. Auch wenn die Grenzen fließend sind, beinhaltete die Strategie im Anschluss an Sun Tzu eine Enthauptung der politischen und militärischen Führung des Gegners (politische und militärische Führung) sowie die Zerstörung der Kommunikationsmöglichkeiten (Kommunikationsmittel), die der Verteidigung Bagdads im Anschluss an Clausewitz dagegen einen langandauernden Volkskrieg.
Unsere Annahme, dass keine der beiden Strategien für alle denkbaren Fälle anwendbar ist, ergibt sich daraus, dass ein Enthauptungsschlag im Falle einer netzwerkartigen Struktur des Gegners (etwa den Taliban) keineswegs erfolgreich sein muss oder durch die Enthauptung eine solche Struktur erst entsteht (Irak). Umgekehrt ist das viel beschworene Clausewitz’sche Gravitationszentrum (Center of Gravity) kein sinnvolles militärisches Ziel, wenn dieses eher ideologischer Art ist oder auf alten Traditionen beruht, wie dies Napoleon im spanischen Krieg schmerzhaft erfahren musste
Der Ansatz von Sun Tzu bezieht sich stärker als der von Clausewitz auf das Denken des Gegners. Sein methodischer Ansatz zielt auf eine leidenschaftslose Einschätzung der strategischen Situation und damit auf die Erlangung von innerer Distanz zum Geschehen als einer Form von Objektivität. Dieses Vorgehen wurzelt im Taoismus, in dem die Präsentation von Paradoxien zur Methode erhoben wird. Offensichtlich wird dies in folgendem zentralen Paradox:

"In all deinen Schlachten zu kämpfen und zu siegen ist nicht die größte Leistung. Die größte Leistung besteht darin, den Widerstand des Feindes ohne einen Kampf zu brechen."
In deutlichem Widerspruch zum übrigen Buch, das von der Kriegführung auf dem militärischen Schlachtfeld handelt, formuliert Sun Tzu hier das Ideal eines Sieges ohne Kampf und kommt damit dem Ideal hybrider Kriegführung sehr nahe, in der der direkte Kampf nur eine von mehreren Optionen ist. Dementsprechend hat später der britische Stratege Basil Liddell Hart formuliert: „Das feindliche Nervensystem zu paralysieren ist eine wirtschaftlichere Operationsform als Schläge auf den feindlichen Körper.“
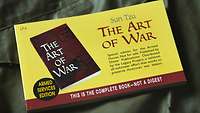
Fester Bestandteil der Taschenbuchbibliothek für USUnited States-Soldaten während des Zweiten Weltkriegs: “The Art of War” von Sun Tzu.
akg-images / Matthias LüdeckeSun Tzus „Die Kunst des Krieges“ konzentriert sich stark auf den rein militärischen Erfolg, lässt jedoch die politische Dimension im Hinblick auf die Situation nach dem Krieg vermissen. Dies ist eine Folge der Umstände, unter denen Sun Tzu lebte, denn in seiner Zeit der nicht enden wollenden Bürgerkriege standen der militärische Sieg und das eigene Überleben absolut im Vordergrund.
Um sein Ideal zu erreichen, stellt Sun Tzu drei Kernelemente in den Mittelpunkt seiner militärischen Strategie:
Die drei Kernelemente der Strategie von Sun Tzu ließen sich in unserer Zeit nicht ohne Weiteres anwenden: Eine generelle Täuschung des Gegners birgt die Gefahr, auch die eigene Bevölkerung zu täuschen, was für jede Demokratie problematisch wäre. Eine indirekte Strategie im Allgemeinen würde die Abschreckung gegenüber einem Gegner schwächen, der schnell und entschlossen handeln kann. Die Konzentration auf die Beeinflussung des Willens und des Verstandes des Gegners kann ihn in die Lage versetzen, einen Kampf zu vermeiden und ihn zu einem späteren Zeitpunkt zu günstigeren Bedingungen lediglich wieder aufzunehmen.
Der Grund dafür ist, dass Sun Tzu nie an der Gestaltung der politischen Verhältnisse nach dem Krieg interessiert war, denn er lebte in einer Zeit der scheinbar nicht enden wollenden Bürgerkriege. Das einzige Gebot für ihn war es, zu überleben und dabei den geringstmöglichen Preis zu zahlen und Kämpfe zu vermeiden, denn selbst ein erfolgreicher Kampf gegen einen Feind konnte einen schwächer zurücklassen, wenn der Moment gekommen ist, den nächsten Feind zu bekämpfen.
Schließlich muss man berücksichtigen, dass Sun Tzus Strategie vermutlich im Hinblick auf einen Gegner mit einer sehr schwachen Ordnung der Streitkräfte oder der dazugehörigen Gemeinschaft erfolgreich ist, wie zum Beispiel Kriegsherrensysteme und Diktaturen, die zu Sun Tzus Lebzeiten die üblichen Gegner waren. Sein Buch ist voll von Fällen, in denen relativ einfache Aktionen gegen die Ordnung der gegnerischen Armee oder ihres Gemeinwesens zu Unordnung auf Seiten des Gegners führen, bis diese aufgelöst werden oder ihren Kampfeswillen ganz verlieren. Ein solches Vorgehen kann offensichtlich bei Gegnern mit schwachen Streitkräften und einer schwachen sozialen Basis erfolgreich sein, dürfte sich aber bei Gegnern mit einem stärkeren Zusammenhalt von Streitkräften und Gesellschaft als problematisch erweisen.
Hier könnte der Krieg in der Ukraine ein warnendes Beispiel sein. Denn anscheinend war man in der russischen Militärführung beziehungsweise dem politischen Kreis um Putin davon überzeugt, dass dieser Krieg als „Spezialoperation“ wie die Annexion der Krim schnell enden würde, weil weder mit dem Widerstand der ukrainischen Bevölkerung noch deren Armee gerechnet wurde und ebenso wenig mit dem Willen der westlichen Staaten, die Ukraine militärisch zu unterstützen.
Zugespitzt formuliert, könnte man sagen, dass im Irak-Feldzug 2003 Sun Tzu über Clausewitz gesiegt habe, im Krieg in der Ukraine zumindest bis zum Sommer 2023 jedoch Clausewitz über Sun Tzu. Hier zeigt sich auch, dass Kriege im 21. Jahrhundert zwar verstärkt einen hybriden Charakter annehmen, es aber sehr viel schwieriger ist, eine hybride Kriegführung erfolgreich zu praktizieren. Zudem kann der Krieg in der Ukraine als Beleg der größeren Stärke der Verteidigung gelten, wie sie von Clausewitz postuliert worden und Kern des bei weitem umfangreichsten Buches über die Verteidigung innerhalb von „Vom Kriege“ ist. Es ist zuzugestehen, dass Clausewitz in Bezug auf die „Kunst der Kriegführung“ in praktischer Hinsicht wahrscheinlich Sun Tzu unterlegen ist, weil er in Teilen seines Werkes einer einseitigen Verabsolutierung der Kriegführung Napoleons das Wort geredet hat, während er nur im Buch über die Verteidigung eine differenziertere Strategie entwickelte.
Kehren wir zum Anfang zurück, so ist Clausewitz der (praktische) Philosoph des Krieges, Sun Tzu dagegen konzentriert sich auf die „Kunst der Kriegführung“. Wie sich in Kriegen der Gegenwart zeigt, ist aufgrund von technologischen Entwicklungen und dem Prozess, den ich andernorts als „hybride Globalisierung“ bezeichnet habe, jeder Krieg als hybrid zu kennzeichnen.
Hybride Globalisierung ist gekennzeichnet durch die weiter fortschreitende Globalisierung einerseits und lokalen und regionalen Widerstand gegen sie andererseits. Dieser Widerstand ist somit eine Reaktion auf die Globalisierung und damit eine ihrer widersprüchlichen Ausprägungen.
Wie sich aktuell im Krieg in der Ukraine zeigt, unterscheidet sich jedoch die Bestimmung eines Krieges als hybrid von erfolgreicher hybrider Kriegführung. Dies deshalb, weil in hybrider Kriegführung notwendigerweise miteinander unvereinbare Gegensätze kombiniert werden müssen. Diese Vermittlung von Gegensätzen erfordert politische Klugheit sowie die Fähigkeit der Kunst des Krieges. Die idealtypische Entgegensetzung von Clausewitz und Sun Tzu ist an sich richtig, wenn wir diese Gegensätze jeweils mit einem „mehr“ versehen, nicht einem ausschließlichen „oder“.
Trotz dieser idealtypischen Konstruktion ist jeder Krieg durch eine Kombination dieser scheinbaren Gegensätze gekennzeichnet. Die Frage ist folglich weder nach einem „Entweder-oder“ noch einem reinen „Sowohl-als-auch“, sondern die, welche Strategie in einer konkreten Situation die angemessene ist.
Hiervon ausgehend stellt sich die Frage, auf wen von beiden, Clausewitz oder Sun Tzu, in den strategischen Debatten der Zukunft mehr Bezug genommen werden wird. Die Antwort auf diese Frage hängt aus meiner Sicht davon ab, welche Rolle künstliche Intelligenz, Drohnen, Quantencomputer und die Entwicklung von autonomen, robotischen Systemen in Zukunft spielen werden – also welche Rolle das Denken und die „Seele“ im Vergleich zu den materiellen Gegebenheiten in einer globalisierten Welt spielen werden.
Weil der zwischenstaatliche Krieg mit dem Krieg in der Ukraine wieder an die erste Stelle getreten ist, könnte Clausewitz in den kommenden Jahren wieder an Aktualität gewinnen. Sollten indes die umstrittenen Konzeptionen hybrider Kriegführung weiter an Einfluss gewinnen, würde dies eine weitere Stärkung von Sun Tzu ermöglichen, da diese im Kern auf Kriegführung unter anderem durch nicht-staatliche Akteure im staatlichen Interesse beruhen.
Im Krieg in der Ukraine zeigt sich in Russland wohl eine Überschätzung der eigenen Fähigkeiten zur Beeinflussung von Denken und Seele (Identität) einer Gemeinschaft wie der Ukraine. Bezüglich autokratischer Staaten wie Russland und China kann jedoch möglicherweise eine zumindest zeitweise Unterschätzung der Möglichkeiten der Manipulation der Bevölkerung durch die neuen Technologien festgestellt werden.
Unabhängig vom Ausgang des Krieges wird die Auseinandersetzung um Clausewitz und/oder Sun Tzu als endlose Geschichte weitergehen – dies sollte aber nicht als reine Wiederholung von dogmatischen Auseinandersetzungen vor sich gehen, sondern die Frage beantworten, mit welchem von beiden in welcher Situation der bessere Ansatz verfolgt werden kann, um Kriege besser zu verstehen.
Carl von Clausewitz, Vom Kriege. 19. Aufl., Bonn 1991
Andreas Herberg-Rothe, Der Krieg. Geschichte und Gegenwart. Eine Einführung. 2. wesentlich erweiterte Auflage, Frankfurt am Main 2017
Sunzi, Die Kunst des Kriegs. Hrsg. und mit einem Vorwort von James Clavell, München 1988.